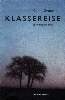| Klassereise | |
|
Vermisste Gemeinschaft
Ivar Bakke - Morgenwelt
- 23.april 2001 "Die beiden Eigenschaften, die das menschliche Dasein am wenigsten entbehren kann, nämlich Freiheit und Geborgenheit, - beide unumgänglich notwendig - lassen sich ohne Reibungen nur schwer miteinander vereinen. Die beiden Qualitäten sind zugleich komplementär und unvereinbar; die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Konflikt miteinander geraten, ist und war schon immer genauso groß, wie das Bedürfnis, beide miteinander zu vereinen." So heißt es bei Zygmunt Bauman in seinem kürzlich in einem norwegischen Verlag veröffentlichten Essay über "Vermisste Gemeinschaft. (Englischer Titel: "Community" , Polity Press, 2000 - Amn.d.Red.) Der
Schwerpunkt dieses reichhaltigen schmalen Buches besteht in der
Analyse folgender Züge der gegenwärtigen Gesellschaft: Das moderne
Zusammenleben in einer Gemeinschaft ist in zunehmendem Grade von
Instabilität und Vorläufigkeit gekennzeichnet. Die Brüchigkeit von
Gemeinschaft hinterlässt das Gefühl der Entbehrung. Zugleich ist die
Konzeption von Moderne als einem gemeinsamen Projekt, wo jeder Mitbürger
ist mit seinen Verpflichtungen und dem Anspruch auf soziale
Geborgenheit, unter Druck geraten. Mobilität und persönliche
Anpassungsfähigkeit sind wichtiger geworden als Loyalität und
Gruppenzugehörigkeit. Immer weniger Menschen glauben an die Möglichkeit
oder den Wert von langfristigen, kollektiven Strategien. Und in dem.
Maße, da der kollektive Anspruch und die Forderungen, welche die
Gesellschaft als Ganzes an das einzelne Individuum richtet, schwinden,
lässt auch das Vertrauen des Einzelnen in die Gesellschaft nach:
Darauf, dass die Gemeinschaft für sie sorgen wird, vertrauen
zusehends weniger Menschen. Baumans
Essay mahnt uns, nicht zu vergessen, dass in unserem Jahrhundert märchenhafte
Fortschritte stattgefunden haben, welche die Not der Abermillionen von
Armen und Hilflosen milderten. Dies ist nur erreicht worden, weil man
die Beseitigung der Armut als kollektive Verantwortung auffasste; die
Frage wurde politisiert, und nicht individualisiert, wie dies in
unseren Tagen geschieht. Den Armen war es einst aus materiellen Gründen
nicht möglich, ihre formalen Freiheitsrechte zu verwirklichen (was
allerdings kein Argument gegen die Freiheit ist, wie dies einst fälschlicherweise
viele Marxisten glaubten). Die allgemeine Angleichung der materiellen
Verhältnisse hat die "Chancengleichheit" verwirklicht und
es dem Einzelnen ermöglicht, seine eigene Lebensführung einigermaßen
frei wählen zu können - was die Armen früher nie konnten. Heute
jedoch, wird versucht, diesen historischen Vorgang rückgängig zu
machen - und zwar mit der propagandistischen Begründung, dass die
Freiheit nun an allen Fronten siege. Wie
haben sich die Intellektuellen dieser gegenwärtigen Herausforderung
gestellt? Laut Bauman haben viele der postmodernen Intellektuellen
ihre Resignation mit geschönten Begriffen bemäntelt. Wenn Stadtteile
an ethnischen Trennungslinien entlang ghettoisiert werden, ist es
unangebracht, dies mit Lobreden über unsere bunte und spannende
Multikultur gutzuheißen. Diejenigen, die tatsächlich gezwungen sind,
in ethnischen Ghettos zu leben, wissen nur allzu gut, dass "Stigmata
und öffentliche Erniedrigung keineswegs die Leidenden zu Brüdern
macht", dies ist keine "natürliche", sondern eine unwürdige
und unfreiwillige Schicksalsgemeinschaft. Die globale Elite mit ihrem
"querkulturellen" Leben bewegt sich in der Tat in einer
sozialen Blase von Gleichgesinnten, ohne jede verpflichtende, ständige
Beziehung zu Leuten aus anderen Kulturen oder sozialen Schichten zu
unterhalten. Bauman fürchtet die "Tribalisierung" und
Zersplitterung der Gesellschaft und verweist auf die Elemente von
sozialem Zwang, die sich notwendigerweise ergeben, wenn ethnische
Identität als Ersatz für die mitbürgerliche Gemeinschaft dienen
soll. Der Masse solcher Ghettobewohner fehlt ja auch jede materielle
Basis, um die soziale und kulturelle Mobilität, welche die "Meritokratie"
dieser globalen Elite kennzeichnet, nachahmen zu können. Eine
norwegische Autorin, Karin Sveen, hat neulich über das Thema der
sozialen Zugehörigkeit und Herkunft geschrieben. Ihr Buch behandelt
mehrere Aspekte, die auch Baumans Essay berührt. Beide Autoren lehnen
es strikt ab, einer Identitäts-Schwärmerei zu folgen, welche
"die gute alte Zeit" lobt. Laut Sveen "bezeichnet dies
eher Furcht und Verachtung für die Gegenwart, als die Liebe zu dem
Vergangenen, und eher eine Frontstellung gegen das Fremde, als ein Ort
der Geborgenheit im Vertrauten." Sveen
gehört zu den vielen Leuten, denen in der Nachkriegszeit ermöglicht
wurde, aus ihrer sozialen Schicht auszubrechen. Ihr "lebensgeschichtlicher
Essay" heißt "Klassenreise". Schon damals nannte man
diese Schicht nicht "Arbeiterklasse", und auch jetzt klingt
diese Bezeichnung beinahe obszön. Die Mittelklasse fühlt sich
dadurch beleidigt und die Arbeiterklasse fühlt sich abgewertet. Aber:
Wie kommt es eigentlich dazu, dass man in einer Zeit, welche die
kulturellen Unterschiede bejaht, so ungern über die unterschiedliche
soziale Herkunft spricht? fragt Karin Sveen. Und sie fragt, in welchem
Ausmaß ihr sozialer Hintergrund die Reise geprägt hat, damals, als
es ihr und abertausenden anderer Leute möglich war, ihre alte
Lebenswelt zu verlassen und sich hinein in das Neue, Unbekannte zu
begeben. Ihre
Ansicht verweist vor allem auf eine ambivalente Haltung. Die Loyalität
zu ihrem Herkunftsmilieu ist noch da, zeigt sich aber eher als eine
Haltung des Verständnisses, denn der Kritiklosigkeit. Karin Sveen
spricht über eine ihr eingeprägte soziale Erfahrung: das Gefühl,
dass einem ein geringerer Wert zukommt. "Es lohnt sich nicht, zu
rebellieren." Dann folgt: "Bleib’, wo du bist, oder
glaubst du, besser als wir zu sein?' Entfremdung und Schamgefühl
drohen jedem, der aus diesem. Herkunftsmilieu ausbricht. Anderseits:
Wie verhält es sich mit der bürgerlichen Kultur und Bildung, die
geradezu "weltfremd" - das deutsche Wort passt hier
ausgezeichnet! - und ahnungslos gegenüber diesem sozialen Hintergrund
zu sein scheint? Karin Sveens frühere Lebenswelt und ihr Idiom galten
nicht als "normal" oder repräsentativ, weil sie in der
Literatur nicht repräsentiert wurden. Das fiel auf und unterschied
sich von dem Hintergrund der Mittelklasse, der eben überhaupt nicht
als "Klassen-Hintergrund" galt. Die
Autorin fühlt sich aber auch in der Arbeiterpartei nicht zuhause:
letztere erscheint ihr allzu kritiklos und anti-intellektuell. Die
"Sozialistische Linkspartei mit ihren bürgerlichen Rebellen und
den ewigen Debatten, schien ihr zwar viel. weltoffener zu sein - es
erwies sich allerdings, dass diese Partei keine Ahnung von jener
Arbeiterklasse hatte, die sie zu verehren vorgab. Das hat sich leider
kaum geändert. Was
will Sveen also mit ihrem Buch sagen? Es geht darin um viel mehr als
bloß
um persönliche Vergangenheitsbewältigung. Ihr Buch richtet sich
gegen die "modernisierte" Arbeiterpartei, die viele
historische Chancen verpasst hat, aber einige noch zu bestehen hat.
Wie kann die Kluft zwischen den Milieus so überbrückt werden, dass
die Arbeiterklasse es für möglich hält, einen größeren
Teil der "bürgerlichen" Kultur als einen Teil ihrer eigenen
Lebenswelt zu begreifen? Und wie kann man verhindern, dass die
Entfremdung der Arbeiterpartei von ihren traditionellen Wählern dazu
führt, dass eben diese Wähler in die Arme der populistischen, völkischen
Rechtsradikalen getrieben werden? Es
besteht natürlich die Gefahr, dass sowohl Bauman, als auch Sveen von
jenen als "ewig gestrige" Autoren abgestempelt werden, die
sich von deren Botschaft verunglimpft fühlen. Eine solche Einschätzung
scheint mir grundfalsch zu sein. Mit ihrem Buch bewegt sich Karin
Sveen in einem Bereich, für den wir fast kein adäquates Vokabular
haben. Ihr Bemühen, uns ihren Erfahrungen näher zu bringen, hat es
verdient, wahrgenommen zu werden. Es wäre zu wünschen, dass ihr Buch
auch in anderen Sprachen veröffentlicht würde. Zygmunt Bauman ist mit seinen nunmehr 75 Jahren erstaunlich flexibel, was seine Bereitschaft zum "Umdenken" angeht. Er steht mitten in seiner Gegenwart. Beide Autoren haben uns ein Werkzeug an die Hand gegeben, mit dem diese Gegenwart besser zu verstehen ist. Dennoch: Es ist bedauerlich, in welchem Ausmaß der akademische Sprachgebrauch ihre eigene Sprache beeinflusst hat. Sveen und Bauman schreiben nicht für, sondern über Herrn Jedermann. Ob es möglich ist, ihre Bücher vorzustellen, ohne ihre esoterischen Bandwurmisätze nachzuahmen, bleibt dahingestellt. Ich jedenfalls, schaffe es leider nicht. |
|
|
|
|
| Biografi Oppdrag Bibliografi Forside | |
|
|
|
|
Kopirettigheter © Karin Sveen Design Kihl |